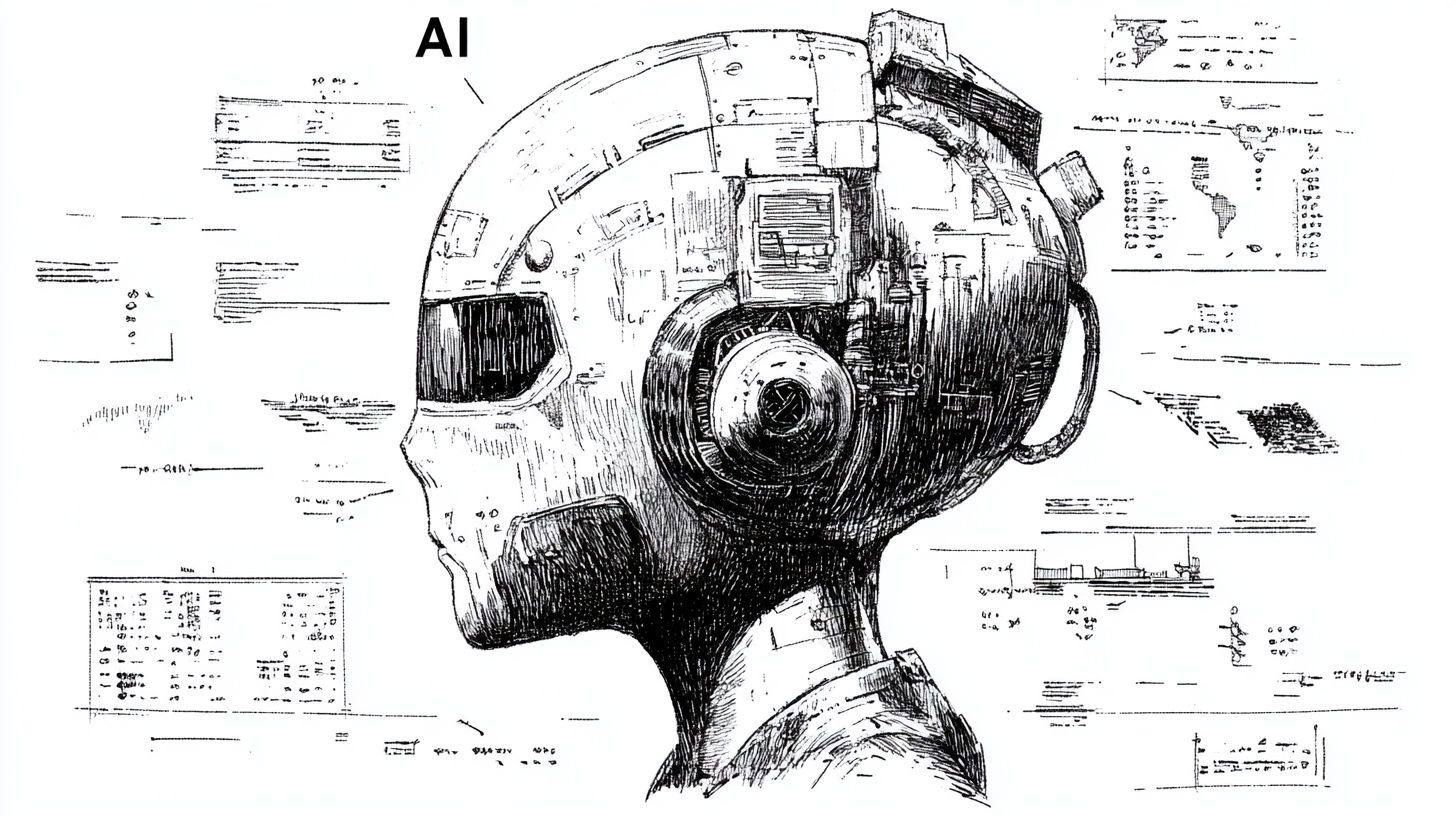Juli 2025
Nur 32 Prozent aller Menschen in Deutschland vertrauen laut einer Studie von KPMG und der University of Melbourne KI-Tools. Auch fast die Hälfte fühlt sich nicht in der Lage, KI-Anwendungen angemessen zu bewerten. Und nur 37 Prozent glauben, dass für sie persönlich die Chancen die Risiken überwiegen. Gleichzeitig nutzten aber im Februar 2025 zwei Drittel KI beruflich, privat oder in der Ausbildung. Und laut einer Umfrage von EY prüfen auch nur 27 Prozent der Nutzenden in Deutschland die Ergebnisse von KI-Tools wie ChatGPT.
Wie geht das zusammen? Hohe Nutzungsraten, wenig Vertrauen und trotzdem Verwendung der Ergebnisse und Übersetzungen ohne Prüfung.
Fehlende konkrete Aufklärung und Schulung kann ein Erklärungsansatz sein. So liegt Deutschland laut der zuvor schon genannten KPMG-Studie bei der KI-Kompetenz (KI-Literacy) auf dem vorletzten Platz der 47 untersuchten Länder und damit hinter vielen anderen Industrieländern.
Aber auch andere Gründe sind denkbar. So reduzieren KI-Tools den persönlichen Zeitaufwand und werden immer mehr zum Bestandteil der natürlichen Arbeitsumgebung, wie bspw. die Integration von KI-Antworten in die Google-Suche zeigt.
Aus den genannten Studien und Umfragen geht nicht hervor, ob Nutzende KI-Anwendungen im beruflichen Kontext anders verwenden als privat. Das wäre ein sehr spannender Aspekt für weitere Untersuchungen. In jedem Fall gilt aber: Wer exakt recherchieren muss, kann sich nicht allein auf KI verlassen. Denn KI-Tools sind keine Quelle, sondern nur ein Agent, der Ergebnisse aus den Quellen sucht und zusammenfasst. Die Bewertung, ob eine Quelle vertrauenswürdig ist, bleibt Aufgabe eines jeden Researchers.
Bildnachweis: © [2024] [KI-Gen.] Marcel Ohrenschall. Basierend auf Werken von Andreas Ohrenschall.